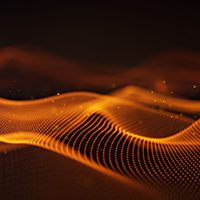Letztens beim Zusammenzimmern seines Carports wollte das Handgelenk von TK-Vorstand Jens Baas einen Krankenwagen rufen. Genauer gesagt war es seine Smart-Watch, die das Hämmern als Zeichen eines schweren Sturzes wertete. Auch wenn die Uhr in diesem Moment falsch lag, zeigt sie doch das Potenzial, das in einem digitalisierten Gesundheitswesen steckt. Eine Uhr, die bereits mit den eigenen Gesundheitsdaten verknüpft ist, könnte zum Beispiel einschätzen, ob ein erhöhtes Schlaganfallrisiko vorliegt – und im Notfall Hilfe anfordern. So Baas’ Vision. Deutschland befinde sich nun in der Aufholjagd, was die Digitalisierung im Gesundheitssystem angeht.
TK-Chef Dr. Jens Baas im Gespräch
„Wir müssen Grenzen verschieben“
Die E-Health-Revolution hat Dr. Jens Baas, Chef der Techniker Krankenkasse, schon lange im Fokus. Im Interview rät er, die digitale Zukunft des Gesundheitswesens ganz genau im Blick zu haben.

20.06.2019 Miriam Meißner